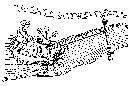Günther Pedrottis Ingenieurs-Kunst im Salesgraben - mit Bildern und Text von G. Pedrotti
Man steigt nicht zweimal in denselben Fluss. Doch! – sagt Günther Pedrotti und macht sich ans Werk: Der Fluss soll gegen den Strom fließen. „Und sie dreht sich doch!“, soll Galilei über die Erde gesagt haben, bevor man ihn ins Gefängnis warf. Als Columbus sein ominöses Ei kräftig auf die Tischplatte drückte, war das auch so ein trotziges: Doch! „Mit dem Kopf durch die Wand“ ist ein Werktitel Günther Pedrottis.
Heutige Erfinder- und Entdecker-Karrieren laufen anders – in Großlabors sorgt man sich gemeinsam um die kontinuierliche Legitimation des eigenen Tuns gegenüber den Investoren.
Günther Pedrotti arbeitet in keinem Großlabor, sondern im Wald. Arbeitet nicht als gegenüber Verwertungsinteressen verantwortlicher Ingenieur, sondern als Künstler. Aber in seinem Tun lebt ein Gestus fort, dem die Menschheit die historische Entfaltung ihres wissenschaftlichen Wissens und ihrer technischen Naturbeherrschung verdankt. Ein renaissancehafter Gestus der Selbstbehauptung gegenüber dem Universum, der heute dem Wissenschafter abhanden gekommen ist und nur noch vom Künstler festgehalten und gelebt werden kann. Auge in Auge mit dem Allgemeinsten der Natur steht der forschende denkende Mensch heute mitunter da wie am Beginn aller Wissenschaften, wie als Vorsokratiker, staunend, wie als Sokratiker, mit dem Wissen ums letztendliche Nichtwissen. Wie als Aristoteliker, von vorn beginnend mit der Welterkundung. „Der Anfang, der Urgrund aller Dinge ist das Wasser.“ Zweitausend Jahre, und kein bisschen weiser? Günther Pedrotti ist auch Forscher, ein passionierter Leser wissenschaftlicher Texte. Die tausend Theorien seit Thales, dem antiken Wasserphilosophen, sind ihm vertraut. Grund genug, wieder ganz von vorne zu beginnen, wenn man den Dingen auf den Grund gehen will. Der Archimedische Punkt, von dem aus man die Welt aus den Angeln heben und wohl auch den Lauf der Flüsse umkehren (Abb. 1+2) könnte, harrt immer noch seiner Entdeckung. Warum sollte er sich nicht im Salesgraben finden lassen?
Wenn Günther Pedrotti Wasser aufstaut (Hemmung - Abb. 3), um dann ein Rohr im Bach zu versenken, durch das inmitten des Baches dessen Wasser in umgekehrtem Gefälle gegen den Strom rinnt, zurück zur Quelle, dann ist eine metaphorische Zeitmaschine entstanden, die es möglich macht, tatsächlich zweimal in den selben Fluss zu steigen. Womit weder die physikalischen Gesetze der Schwerkraft und Hydraulik, schon gar nicht Thermodynamik und Zeitpfeil widerlegt sind, immerhin jedoch ein mehr als 2000 Jahre alter Satz, der erstmals einen physikalischen Zeitbegriff statuierte, indem er Zeit mit einem physikalischen Phänomen, dem Wasserfluss, verkoppelte. Nicht in die Physik, sondern ins physikalische Denken interveniert Günther Pedrotti, und geht dabei zurück bis an die ersten Quellen abendländischer Theoriebildung.
Nun hat der Künstler im Salesgraben eine zum Bach parallele Leitung verlegt, die er „Führungsrinne“ nennt; eine Folge von aneinander gefügten Rohren, die aus einem Gerinne zwei machen. Eine simple Anordnung zunächst – wohin führt dieser verdoppelnde Eingriff in die Natur?
Zunächst ein kleiner Exkurs in die Ästhetik der Verdopplung. Sie ist die simpelste Maßnahme, mit der man Vorgefundenes in Gewolltes verwandeln kann. Ich erinnere mich an den Anblick einer sehr alten und gleichwohl auffallend modisch gekleideten Dame auf der Wiener Kärntnerstraße, deren Beine – offenbar durch Krankheit bedingt – extrem dünn waren, Haut und Knochen, und sehr unansehnlich. Diese Dame führte nun einen Windhund mit sich, jene Rasse, die sich durch die allerdünnsten Beine und eine generell modisch-elegante Anmutung auszeichnet. Der Hund hatte die präzise ästhetische Funktion, die Entsetzen auslösenden dürren Beine der Dame durch Verdreifachung ihrer Anzahl in modische Accessoires zu verwandeln. Der Hund addierte den Index des Gewollten, der überbietenden Sonderform, die modische Hybris zum vorgefundenen Naturkörper. Das Gebrechen hob er auf in die Sphäre der Zeichen, des Schmucks, des verschwenderischen Zusatzes. Weniger als brauchbar, doch mehr als notwendig waren die sechs Stelzen von Dame und Hund insgesamt. Wir kennen das vom Lied und von der Lyrik, was es macht, wenn ein Wort zweimal hintereinander gesagt wird. Die Bedeutung verschiebt sich, und der strukturelle Überschuss des Poetischen fließt zurück ein in den primären Wortsinn. Hier nimmt das Ästhetische seinen Anfang.
Mit der Verdopplung ohne Zweck tritt man über aus der Natur in die Kultur, vom Realen ins Symbolische, vom Passiven ins Aktive, vom Notwendigen ins Luxuriöse. Aus dem Betrachteten wird ein Zeichen, die Realität wird zum Theater. Theater ist, wo jemand erschossen wird, und die Zuschauer rufen nicht die Polizei, sondern beginnen zu klatschen. Schließlich befinden sie sich in einer Realität zweiter Ordnung, im Himmelreich des erscheinenden Möglichen. Oder, mit einem Wort von Karl Marx, aus dem Reich der Zwecke tritt man hinüber ins Reich der Freiheit. Zumindest der künstlerischen Freiheit, möchte man heute ergänzen.
Künstlich und kunstartig ist indessen im Salesgraben nicht etwa bloß die Führungsrinne, im Gegensatz zum Bach, der weiter Natur bliebe: Die Intervention lässt den Bach zwar real weiter bestehen, symbolisch aber wird seine Erscheinung von seiner Überarbeitung angesteckt. Der Naturbach hat als Teil eines Kunstwerks seinen Kontext gewechselt, er ist in den Inszenierungs-Zusammenhang einbezogen und kann nicht mehr mit den gleichen Augen wie zuvor betrachtet werden. Der Bach ist kein reiner Naturbach mehr, er ist ein Kunstbach geworden. Die Bedeutung rinnt vom einen ins andere Gerinne über. Bedeutungen und die von ihnen vorgeprägten Wahrnehmungen lassen sich nicht so genau kanalisieren wie Gewässer in Rohren, sie diffundieren, benetzen ihre Nachbarschaft, befeuchten ihre gesamte Bedeutungsumgebung. Metaphern wuchern und streuen sich aus, es gibt kein Rohr, in das man sie sperren könnte. Leiten kann man zwar Informationen, aber nicht Bedeutungen. Auf der Seite des Empfängers hat dieselbe Information immer eine andere Bedeutung, als auf der Seite des Absenders.
Der Ort des Kunstwerks ist nach dem Maler Sales benannt. Das erinnert daran, dass auch jene Phase der Kunstgeschichte, in der man das Abbilden von Naturteilstücken gepflegt hat und den Namen des abbildenden Malers in die rechte untere Ecke der Abbildung handschriftlich einzutragen gepflegt hat, dass auch diese Naturverdopplungs-Intervention unseren Blick auf die Natur gründlich verwandelt hat. Historische Forschungen haben ergeben, dass es eine sehr späte Erfindung war, Natur als Landschaft wahrnehmen zu können, und dass die Malerei einen wesentlichen Beitrag zu dieser Erfindung einer ganz bestimmten, heute selbstverständlich gewordenen Wahrnehmungsweise geleistet hat.
Ein Ölgemälde, das einen Bach im Wald abbildet, ist ja auch eine Verdopplungstechnik des Vorgefundenen mit Rückwirkung auf die Wahrnehmung des Vorgefundenen. Ist auch eine Technik der Überführung des Bestehenden ins Reich des Ästhetischen und Symbolischen. Aus der Natur wird etwas herausgeschnitten und verdoppelt, wiedergegeben, verschoben gespiegelt, zum Vorbild passend. Das Wort Symbol heißt ursprünglich „passendes Bruchstück zweier Scherben“. Die Bruchlinie, die das Symbol macht, ist die zwischen dem Bach und seinem linearisierten Ableger, der Führungsrinne.
Günther Pedrottis Wasserlauf-Parallelisierung hat nicht nur etwas Naturalistisches im Sinne einer Nachbildung der Natur, sondern mehr noch etwas Abstrahierendes. Beinahe hundert Jahre ist es her, dass Naturalismus und Abstraktion einen langen Kampf in der Kunst vom Zaun gebrochen haben. Geometrisierung, Konstruktion und das Zusammensetzen aus gleichförmigen Elementen waren die wesentlichen Spiel-Einsätze der Ära der Abstraktion vom Kubismus bis Mondrian. Günther Pedrotti inszeniert mit Baumarkt-Röhren ein kubistisch-abstraktes Nachbild des natürlichen Wasserlaufs inmitten eines Landschafts-Genrebild-Vorbilds. Bauhaus-Stil mit Baumarkt-Elementen also, rückverschoben ins Romantik-Szenario, sodann vergegenwärtigt als konzeptuelle Installation. Der Künstler wählt, zugegeben, für seine abstrahierende Darstellung eines Waldbächleins ein ungewöhnliches Medium, Baumarktrohre, und eine seit Jahrhunderten verschwundene Kunstform, die Ingenieurskunst.
Der berühmteste Ingenieurskünstler war Leonardo da Vinci. Von ihm existiert eine Zeichnung (Abb. 4), die einen Philosophen zeigt, der sinnierend neben einem Bach sitzt. In das Wasser ist mittels einer technischen Vorrichtung ein Stab gesenkt, der auffallend regelmäßige Wirbelformen im Wasser erzeugt. Der Eingriff bringt das amorphe, ansonsten chaotisch sprudelnde Medium Wasser dazu, ein allgemeines Gesetz in sich zur Darstellung zu bringen. Im Fließen reproduziert sich eine Formation des Strömens, die geometrisch genug ist, um von Leonardo zeichnerisch präzise nachkonstruierbar zu sein. Die Maschine bringt das Wasser dazu, sich formal zu wiederholen und das Strömungsgesetz soweit zu abstrahieren, dass es dem Zeichner und Naturforscher Leonardo auf halbem Weg entgegenkommt.
Die Zeichnung stammt aus einer Zeit, in der es wohl schon Maschinen gab, jedoch nicht, wie es uns heute selbstverständlich ist, als Mittel zu produktiven Zwecken. Lange vor unserer technischen Kultur stand die Ingenieurskunst vorwiegend im Dienst der ästhetischen Kontemplation, des Spiels mit Erstaunlichem, der symbolischen Überlistung der Natur. So waren nicht etwa bloß die Pferdekutschen die Vorgänger des Automobils, sondern der Himmelstrionfo und die Höllenmaschine. * Seit der Antike gibt es Wunderwerke der Technik, die erst aus moderner Sicht als unsinnig, kultisch, zwecklos und verspielt erscheinen. Technik war historisch zuerst Kunst, dann erst Zweckmäßigkeit.
So mündet auch das von Pedrotti dem Bach beigesellte Rohr nicht, wie man vorderhand annehmen möchte, in eine Turbine, Mühle oder sonstige Maschine. Die abstrakte Darstellung des Wasserlaufs mündet in eine abstrakte Darstellung einer Mechanik: schematische Abbildungen von Zahnrädern drehen sich selbstgenügsam frei schwimmend in Kübeln. Sie zeigen die Richtung des Wasserwirbels an, ohne ihn in Anderes übersetzen zu wollen als in Sichtbares, Regelmäßiges, Gesetzmäßiges, Geometrisches. Wie die Wirbel in der Zeichnung Leonardos dienen sie nur als Einladung zu einem beschaulichen Philosophieren, zum Re-Entry ins philosophische Staunen. Ihre Mechanistik ist nur ein Welt-Bild.
Mechanische Darstellungs-Kunst und Abbildungs-Maschinerie kommen auch in den „Liliput-Katastern“ zur Anschauung. Der Grund des Bachbetts wird vom Künstler minutiös dreidimensional vermessen, die Unterwasser-Landschaft Punkt für Punkt in die Aufzeichnungsform eines Kataster-Plans übertragen. Die Formation wird dabei digitalisiert, geometrisiert, abstrahiert. Der unansehnliche, zufällige, fluid amorphe, der bedeutungslose und bislang außerhalb jeder Repräsentation stehende Bach-Grund wird aufgeklärt und in exakteste mathematische Konstruktionszeichnungen überführt. Der dunkle Grund wird geistig rekonstruiert, entmaterialisiert kehrt er wieder als reiner Plan, das Ex-post nimmt die Form des Ex-ante an. Das Kontingente tritt auf in den Formen des Geplanten, als sei ein kristalliner göttlicher Gedanke dem schleimig-amorphen Unter-Grund immanent, der bloß der Sichtbarmachung und der Verständlichmachung durch mathematische Modellbildung harre.
Wo Günther Pedrotti Kübel zu einer geschwungenen Reihe verschaltet (Der Siphon - Abb. 5), als ob sich aus offenen Gefäßen durch serielle Anordnung eine Leitung erstellen ließe, tritt der moderne Unterschied von Kunst und Technik deutlich hervor: Kunst darf scheitern, und es ist ein schönes Scheitern, was in der Technik undenkbar wäre. Hier verhält sich das Wasser nun so gar nicht wie die Elektrizität in einer Leitung, die Information getreulich überträgt; es verhält sich viel mehr wie Bedeutung, indem es überquillt, ausrinnt, eigene Wege nimmt. Vor die Reihe der Kübel montiert Günther Pedrotti einen Pulsor, ein Gerät, das in gleichförmigem Rhythmus staut und freigibt, hydraulisch sich selbst steuernd den Fluss taktet. Hier sind wir metaphorisch der Informationstechnologie nahe. Die Wasser-Maschine ist getaktet wie ein Computer, was fließt ist Information, eine exakte Struktur und Menge, gerichtet im Raum, um am Ende ein ganz ungewohntes Schicksal zu erleiden: aus dem Gefassten und Gemessenen und Getakteten wird das Unfassbare Überflüssige Renaturierte. Rinnsal und Sickerwasser.
Das Wort „fassen“ wird auf das gedankliche Erkennen und auf das umhüllende Formen von Flüssigem gleichermaßen angewendet. Im Zwischenraum dieser beiden Bedeutungen operieren Günther Pedrottis Interventionen. Dieser Zwischenraum ist zugleich der Denkraum der Metaphysik, also jener Philosophie, die aus der Polarisierung von Materie, Körper, Natur einerseits und „immaterieller“ Entitäten wie Geist, Zahl, Begriff, Idee oder Konstruktion auf der anderen Seite ihre Spannung bezieht. Aus dieser Spannung gewinnt die Metaphysik zugleich ihre Bewegungsenergie zur diskursiven Überwindung ihrer apriorischen Dichotomien. Wasser ist in diesem Spannungsverhältnis das ungeistigste Material, weil das bewegt Flüssige am meisten jener Form (und sogar Regelmäßigkeit) entbehrt, die bei Festkörpern das Scharnier (oder die Membrane) zwischen dem materiellen und dem ideellen Aspekt bilden. Wasser ist das Unfassbare schlechthin, zugleich der archaische Provokateur der Entwicklung von Fassungen.
Die mechanische Maschine ist ein weiterer Vermittler zwischen schwerer Materie und mathematisch-physikalischem Geist, in ihr finden sich die Gegensätze von Festigkeit und Beweglichkeit, Trägheit und Gehorsam, wilder Kraft und Vorhersehbarkeit, Willensunterworfenheit und repetitiver Eigendynamik, blinder Mechanik und luzidem Konstruktionsgeist, dunklem Innen und blanker Oberfläche zur Unio Mystica zusammen.
Seit es Rechenmaschinen und in der Folge Computer gibt, ist der Maschinenbegriff aus seiner metaphysischen Aufspreizung zwischen Material-Erde und Geist-Himmel herausgefallen. Die Struktur, also die regelhafte Form der Grenze zwischen den alten Substanzen Materie und Geist, wurde zur neuen Substanz. Diese neue Substanz, die als Zahlen- oder Zeichenkette ebenso wie als Differenz der Differenzen, als Schaltplan und System, als Konstrukt wie als DNA-Struktur, als Programm wie als Algorithmus, als Formalismus, Formel oder auch nur Form gefasst ist, hält unser heutiges Welt-Bild zusammen und wird von der aktuellen Maschinengeneration, von den Computern, veranschaulicht und plausibel gemacht. Im Computer fließt Strom, doch dieses Fließen scheint nichts Strömendes, Rinnendes, Sickerndes an sich zu haben. Der elektrische Strom wirkt hier vollständig gebändigt, in vorgedachte Bahnen der Hardware eingefangen, während auf der Ebene der Software erst das Unberechenbare und Unfassbare als typische „Eigenschaft“ des Computers anwendungspraktisch hervortritt. Obwohl im Modell der Denkmaschine Materie und Geist als kongruente zwei Seiten derselben Medaille erscheinen, kehrt doch in der Praxis die alte Dualität, nun als „Hardware“ und „Software“, wieder. Freilich mit einer wichtigen Vertauschung von Positionen: als fassbar erscheint jetzt die einst dunkle Materie, unfassbar hingegen der Maschinen eigener Geist. Nur noch theoretisch lässt sich das „Verhalten“ eines Computers vollständig verstehen, in der Praxis hat sich die überkomplexe Black Box jenem Laplaceschen Dämon angenähert, in dem die Utopie eines vollständigen Verständnisses der Natur personifiziert ist. Gegenüber dem Computer ebenso wie gegenüber der Natur ist zuletzt Pragmatismus die einzige adäquate Verhaltensweise, nicht nur, wenn es um Technik, sondern auch, wenn es ums kognitive Fassen geht.
Um Günther Pedrottis Intervention in den Kontext des postmateriellen Maschinenbegriffs zu verorten, ist die Erwähnung zweier real existierender Techniken bzw. Maschinen an dieser Stelle hilfreich: Aquapulsor und Flunivac.
Der Aquapulsor (Abb. 6+7) ist eine mechanische, hydraulische Pumpe, die ihre Energie aus dem Gefälle jenes Gewässers bezieht, dessen Wasser sie hochpumpt. Die heutige Variante dieser Technik nennt sich „hydraulischer Bachwidder“, es handelt sich um eine „Wasserhebeanlage, die ohne Fremdenergie arbeitet“. Günther Pedrottis Interesse an diesen Maschinen und ihrer Geschichte speist sich nicht aus ökonomischen oder ökologischen Verwertungsinteressen, sondern aus dem Naheverhältnis, das diese zu den Maschinen des Renaissance-Zeitalters haben. Sie sind nahe am Perpetuum Mobile, denn sie scheinen keiner äußeren Zufuhr von Kraft zu bedürfen. Das Perpetuum Mobile stand im Zentrum des Maschinenbaus, bevor der Geist nützlichen Anwendung die Apparate in den engen Zwischenraum von Wunsch und Ergebnis einspannte und sie zu Mitteln degradierte. Aus heutiger Perspektive erst erscheint das Perpetuum Mobile als fiktiv verabsolutierter Rand-Fall einer energiesparsamen Maschine, wenn nicht als historisches Hirngespinst. Vom Computer her jedoch ist das Perpetuum Mobile als metaphorische Vorform betrachtbar, denn das „Eigenleben der Maschine“ findet in diesem in energetischer Autarkie seinen Niederschlag, während es im kybernetisch sich selbst steuernden Automaten in der Annäherung an eine fiktive „Autonomie“ zum Ausdruck kommt.
Der Flunivac leitet sich her von „fluid Univac“ und meint die flüssigkeitsbasierte Version eines berühmten frühen Computermodells. An diesem, am M.I.T. zu Forschungszwecken entwickelten Computer, der mit Wasserleitungen und Ventilen anstelle von Stromleitungen und Schaltern betrieben wird, lässt sich der aktuelle Maschinenbegriff besonders klar verdeutlichen. Ein Computer ist nur eine Struktur zur Strukturtransformation, die in jeder beliebigen Materie ihren Niederschlag finden kann. Das Programm ist eine reine Form, ist das differenzierende Profil einer beliebigen Materie.
Aquapulsor und Flunivac haben gemeinsam, dass sie durch bloßes Strukturieren und Segmentieren, durch die zeitliche Sequenzierung von Einschnitten in ein amorphes Kontinuum, so etwas wie Eigenleben erzeugen. Beim primitiven Aquapulsor entsteht „Eigenkraft“, der Flunivac „beginnt zu rechnen“.
Strom und Unterbrechung: es sind stets Einschnitte in ein Kontinuum, welche die Natur einer Berechenbarkeit zuführen und in weiterer Folge Maschinisierbarkeit ermöglichen. Regelmäßige Diskontinuität erlaubt eine Projektion von Mathematik in die Materie. So wird die „Welt erfasst“, strukturell ans Denken und an die maschinellen Erweiterungen des Menschenkörpers angekoppelt und mittels Feedbackschleifen stabilisiert. Der digitale Code als Kompilatorik des Differenz-Minimums Null und Eins ist keine vom Computer präformierte Ver-Fassung, sondern die Funktionsweise des Nervensystems selber (Nervenleiter kennen auch nur zwei elektrische Zustände, Ein- und Ausgeschaltensein, Reiz und Nichtreiz – der Rest ist Rekonstruktion, oder auch „Computation“, zumindest im Sinne von Zusammen-Setzung). Der Computer ist sonach bloß eine weitere Ausstülpung der organischen Verfassung des Menschenkörpers in externe Materien zur Ausbildung von Apparaten, von Nervenimpulsleitprothesen.
Strom und Schalter, ebenso wie die strukturelle Formierung des amorphen Wassers zur Artikulation von Differenz an der Grenze zur Fassung werden von Günther Pedrotti metaphorisch an die Leiblichkeit und an die Materie rückgebunden. Ein Blick zurück in die Entwicklungsgeschichte der Lebewesen zeigt eine stete Abfolge von Einstülpungs- und Abspaltungsprozessen von Röhren und Schläuchen: Entoderm, Mesoderm, Ektoderm. Das Nervensystem ist eine parallele Binnensegmentierung des Ektodermschlauchs. Jeder menschliche Embryo wiederholt die Gattungsgeschichte vom Einzeller über das „Lurch-Stadium“ bis zum Wirbel- und Säugetier. Leben ist ein Säfteleitprogramm, es organisiert das Abtrennen und gesondert Zuleiten zu anderen Leitern, es organisiert Schlauchsysteme vom Sehnerv bis zum Harnleiter, von der Aorta bis zur Zirbeldrüse. Selbstorganisierte Materie formiert sich in Verknotungen von Leitsystemen, deren Fluides stets steuernd und gesteuert zugleich ist. Das Herz inmitten ist durch eines aus Gummi mit Elektropumpe ebenso substituierbar ist wie die belebende „Seele“ mittels Schrittmacher. Der psychophysische Parallelismus rinnt zusammen, übrig bleibt der Wasserspiegel als Scheidelinie, bereit zur Allokation der Differenz des Differierenden.
An den Liliput-Kataster, Pedrottis digitale Projektion der Unterwasser-Topographie in eine stark geometrisierende Raster-Zeichnung, schließt der „Floater-Plotter“ nahtlos an, technisch wie konzeptuell. In einem ersten Schritt wurde das Bachbett vermessen, in einem zweiten ein Kataster der geknickten Flächen erstellt. Nun wird, mit einer weiteren von Günther Pedrotti entwickelten und verfertigten Maschine, die zweidimensionale Darstellung zurück in eine dreidimensionale übersetzt. Der Floater-Plotter schwimmt auf der Wasseroberfläche jenes Baches, dessen Grund zuvor vermessen worden war. Das Wort Plotter steht hier metaphorisch für ein digital angesteuertes Darstellungsgerät. In einem schwimmenden Rahmen befinden sich vier bewegliche Platten. Ihre Neigungswinkel werden durch kleine Elektromotoren variiert. Die Elektromotoren werden von einem Computer gesteuert. Der Computer rechnet die Information über die gerade unter dem Gerät befindliche Unterwasser-Topographie um in die entsprechenden Neigungs-Winkel der Platten. Somit entsteht auf der Wasseroberfläche ein abstrahiertes Abbild des vermessenen Bachbetts. Wenn der Floater-Plotter im Bach seine Position ändert, zeigt sich auf dem Wasserspiegel die Geländeformation des darunter befindlichen Grunds in den Formen einer maschinell bewegten Skulptur.
Die Techno-Logik des computationalen Weltbilds tritt hier in einem Landschafts-Szenario auf, das ihm mythologisch entgegengesetzt ist: Der chaotisch-sinnlose, beinahe amorphe Grund eines Natur-Bächleins ist vorweg das Antidigitale und Antimaschinelle schlechthin. Wird dieser Grund in die Simulations-Maschine aufgehoben, entsteht insgesamt nichts Wohlbegründetes. Wir befinden uns nicht nur weiterhin auf schwankendem Grund, es kann uns auch inmitten der digitalen Natur-Technik-Totale so etwas wie die Erfahrung von Grundlosigkeit, ja Bodenlosigkeit ereilen.
Obwohl sich Günther Pedrotti künstlerischer Mittel bedient, die typisch für die Gegenwartskunst sind, nämlich Installationen im Raum, Assemblagen aus Vorgefundenem, konzeptuell aufgeladene Interventionen in alltägliche Szenarien, greift seine Arbeit doch auch zurück auf zentrale Themen und Vorgangsweisen der Kunst- , Technik- und Wissenschaftsgeschichte. Mit einfachen Mitteln werden vielschichtige Kontexte aufgegriffen und herbeizitiert, miteinander neu verkoppelt und ins Fließen gebracht.
* Jörg Jochen Berns: Die Herkunft des Automobils aus Himmelstrionfo und Höllenmaschine. Wagenbach, Berlin 1996
Wolfgang Pauser 2004
Ergänzungen zu den Bildern:
(Abb. 1.+2.) „Schiffahrt gegen den Strom“, betitelt Faustus Verantius in seinem Buch „Machinae novae“ (um 1617) das Kapitel 40. Zweite Abbildung (Abb. 2) um 1430 aus dem „Pour l´histoire des arts mécaniques et de lártellerie“ von M. Berthelot, Paris 1881. Das Schiff erscheint uns einzig als Motor! Es ist keinem weiteren Zweck zugedacht – es nimmt als Motor die Quelle seiner Kraft in Besitz und bewegt sich gleichzeitig dieser Quelle entgegen.
(Abb. 2.) Manlio Brusatin bemerkt dazu in seinem Buch „Geschichte der Linien“-„ Wohl fließt das Wasser von alleine, doch lässt es sich zu Becken verbreitern, in vorgefertigte Bahnen lenken, durch Schleusen aufhalten und über Dämme oder ein natürliches Hindernis treiben, um mit seinem Anprall die Drehungen eines Rades in Bewegung zu halten. Der Mensch ist dem Anschein nach von Arbeit befreit, und die natürlichen Energien des Wassers werden zu edlen dienstbaren Kräften, in einem gleichmäßigen, kreisförmigen Lauf, der Auge und Geist gefällt“. Der Speicher ist, zusammen mit Differenz und Zirkulation, eine der drei Funktionsbedingungen der Thermodynamik – gemeinsam sind sie die Voraussetzungen dafür den Motor zu denken. Eine „Hemmung“ war also nötig um diese Verhältnismäßigkeit, bzw. deren Bewegung in einem geordneten Ablauf überzuführen. In der Uhr - jenes Abbild des Symptoms einer sozialen Vereinheitlichung - dient dazu die sogenannte „Hemmung“(Hemmungsrad). Sie schafft in jenem kurzen Ruhezustand den Moment der Umkehr, womit sie Ordnung in ein scheinbar regelloses Äußeres bringt. Als Teil einer übermächtigen Maschine scheint das “Stauen“ einen Gutteil des Faszinosums der Wasserkraft auszumachen – Wenn Elfriede Jelinek „In den Alpen“ schreibt: „Die Wasserkraft. Immer die Wasserkraft. Immer mehr die Wasserkraft. Und warum? Weil sie halt schon da ist ……“. Dann heißt das nichts anderes, als das wir uns Gegen etwas stellen, das Unvermeidbar ist – sogar gegen uns selbst, wie in der Figur des Maler Strauch aus Thomas Bernhards “Frost“ , der die Begeisterung für die Errichtung von Wasserkraftwerken schlichtweg ablehnt.
(Abb. 5.) Aufnahme eines „Sickersiphon“ bei Cagliara (Italien). Er ist Teil eines zwischen 1907-1957 umgesetzten Projektes, dessen Ziel es war Oberitalien mit einem Netz von Kanälen zu durchziehen..
Wie schon sein Name darauf hinweist, widerspricht der „Bacino di decantazione des sifone“ wohl ganz der eigentlichen Aufgabe des ganzen Systems, nämlich Wasser zu fassen. Manlio Brusatin schreibt – „ …nun sollten sie (die Wasserläufe) in Kanäle gefasst werden und den umgekehrten Weg nehmen, um aus Bodenhöhe in hohe Türme zu gelangen und von da aus verteilt zu werden, klarer und süßer denn je“. Resultat dieser gigantischen Nivellierung des Wasserspiegels und dessen damit verzögerten Absinken auf das Niveau des Meeresspiegels, war damit die Schaffung eines zweiten großen Speichers – ebenbürtig dem großen Reservoire, dem riesigen Speicher Meer.
(Abb. 6.+7.) Der erste selbstständige Bachwidder (hydraulischer Widder) wurde 1796 von dem Franzosen Joseph Michael Montgolfier erfunden. Durch exakte Strukturierung der mechanischen Abläufe scheint der Apparat ohne Fremdenergie zu arbeiten. Der „Aquapulsor“ wurde um 1923 von Baurat Abraham in Berlin entwickelt, auch dieser pumpte jenes Wasser wieder hoch, aus dessem Gefälle er seine Energie gewann.
![]()